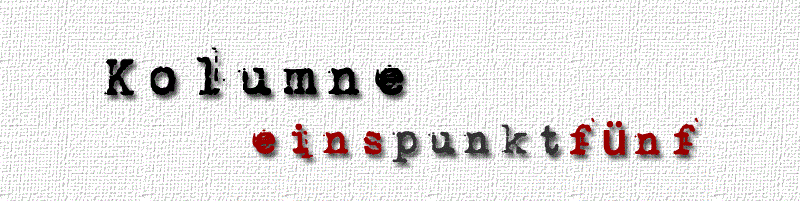Sowohl das Internet als auch ich sind inzwischen alt genug, um miteinander nostalgische Erlebnisse haben zu können. Kürzlich z.B. erlaubte sich mein Mobilfunkanbieter das augenzwinkernde Späßchen, mir für ein aus Gründen angefallenes – man frage mich nicht, es spielten eine plötzlich internetlose Wohnung und ein höchst psychotisches, der Modemersatzlieferung auf kafkaeske Art unfähiges Paketunternehmen eine tragende Rolle – zusätzliches Datenvolumen von 100 Megabyte die durchaus kecke Summe von 2 Euro in Rechnung zu stellen. Da musste ich nostalgisch schmunzeln. Wann hatte das Gigabyte zuletzt 40 Mark gekostet? Das sind ja praktisch Vorkriegspreise! Welcher Krieg, das können historisch bewanderte Ausrechenfreaks jetzt gerne selber ausrechnen. Kleiner Tipp: Meinen Mobilfunkanbieter gab es damals noch gar nicht, Raider hieß noch nicht Twix und Handys hatten größtenteils noch so niedliche kleine Stummelantennen oben dran. Gigabytes waren noch gar nicht erfunden und mit einem Handy Daten zu übertragen, war etwas, das nur futuristische Star-Trek-Menschen mit viel Geduld taten, denn es war in der Regel langsamer, als wenn man sich die Nullen und Einsen einfach gegenseitig am Telefon vorgelesen hätte. Die Preise pro Kilobyte zeugten hingegen von pubertärem Selbstbewusstsein einer jungen Branche mit erstem Bartwuchs. Es kostete sogar noch erheblich mehr als das auch nicht gerade billige Telefonieren, welches man heutzutage ja praktisch schon als fipsige Dreingabe geschenkt bekommt, wenn man seine Gigabyte-Tarife zu Bratwurstpreisen einkauft. Damals jedoch waren Datenpäcken in den Handy-Netzen quasi Luxuspassagiere, die mit goldenen Kutschen und Kaviarverköstigung von Ort zu Ort chauffiert wurden, und so ähnliche Datenpakete musste ich dann wohl kürzlich auch unwissentlich verschickt haben – pelzgewandetete kleine Zaren-Daten, die in einem eigenen Orientexpress am sonstigen Digitalpöbel vorbeigeschleust wurden. Die Textnachrichten sahen allerdings aus wie immer. Taten sie auch damals schon.
Ich würde jetzt bei aller schmunzelnden Nostalgie nicht so weit gehen, jene Zeiten als „gute alte“ zu bezeichnen, aber so rundweg schlecht waren sie jetzt auch nicht. Ich hatte damals als studentische Aushilfe bei Mannesmann Mobilfunk 18 Mark Stundenlohn und einen eigenen Parkplatz – so gut ging es mir danach sowohl lohn- als auch parkplatztechnisch lange Zeit nicht mehr. Meine nicht gerade geistige Überforderung generierende Aufgabe bestand hauptsächlich darin, die von Mobilfunkkunden eingesandten Schriftstücke mithilfe rustikaler Scanner-Ungetüme zu digitalisieren, auf dass sie für die Nachwelt erhalten blieben bzw. die „Zwölfzwölf“ (dereinst gängiger liebevoller Terminus für die D2-Hotline) ihres Inhalts im Bedarfsfall ohne stundenlanges Papiergewühle habhaft werden konnte. Beeindruckende Türme gelber Postkisten voller erquicklicher Konvolute harrten täglich unser aller fleißiger Hände, und so manches Schmuckstück menschlicher Kreativität wie auch Abgründigkeit wurde einem da offenbar. Bis zum Sterbebett in Erinnerung bleiben wird mir wohl zum Beispiel jener schwer leserliche Faxzettel, auf welchem ein genervter Mitmensch um Zuteilung einer neuen Handynummer bat, da er unter der alten wiederholt Anrufe eines nicht ganz koscheren Individuums erhielt, welche offenbar diverse Analpenetrationspraktiken mittels stangenförmiger Nahrungsmittel, vornehmlich Mohrrüben, zum Inhalt hatten, und er sähe bereits sein – ich zitiere – „bis dahin ungetrübtes Verhältnis“ zum Wurzelgemüse irreperabel zerrüttet und erhoffe sich schnellstmögliche Abhilfe, bevor erwähntes Individuum – und ich zitiere abermals – „seine erste Bratwurst im Arsch stecken hat“. Das ist zwar im Detail etwas unglaubwürdig – wer wie ich zu jener Generation gehört, die von waschechten Nachkriegsmüttern und deren fanatischer Hingabe an bis zur Unkenntlichkeit zerkochte Gemüsestampfnahrung jeglicher Art großgepäppelt wurde, kann niemals ein völlig ungetrübtes Verhältnis zu Wurzelgemüse entwickelt haben – aber lustig war es allemal, sich das vorzustellen.

Zudem hatte ich damals das Privileg, einem sog. Wirtschaftskrimi aus allernächster Nähe beiwohnen zu können, denn die Übernahme von Mannesmann durch Vodafone war in vollem Gange, täglich erreichten uns interne, hochgeheime Emails von irgendwelchen hysterischen Betriebsräten, und Angestellte wie Aushilfen lungerten tagelang in hübschen kleinen Menschentrauben vor Bildschirmen mit Intranetseiten und Radios mit Lokalsendernachrichten und verfolgten die Fusion wie ein Tennismatch. Natürlich wollte kaum einer so einfach feindlich übernommen werden, es sollte noch dauern, bis Konzernfusionen zum Volkssport wurden und einschlägige Institute Schnupperkurse für interessierte Laien anboten. Rot-Grün hatte die steuerbefreite Unternehmensausweidung gerade erst erfunden, aber man ahnte bereits, dass das irgendwie alles nix Gutes bedeuten konnte. Nur die ganz Mutigen mit Zeitvertrag waren folglich für Vodafone, die hatten dann ihre eigenen, etwas abseits verorteten Menschentrauben. Den käsigen Engländer „von da drüben“ mochte natürlich keiner, „unser“ Klaus Esser galt abwechselnd als Kacketyp und Geheimwaffe. Von der SPD erwartete man schon damals nicht mehr allzu viel, auf die Gewerkschaft wiederum war ebenfalls kein Verlass, die hatte in diesem speziellen Fall nämlich gerade ganz andere Sorgen.
Denn wie vieles sonst war damals auch noch in der Schwebe, vor welcher Gewerkschaft Karren „wir Mobilfunker“ denn nun eigentlich und schlussendlich zu spannen wären. Waren wir noch immer heimliche Stahlarbeiter (wg. Mannesmann) oder doch ausgebeutete Dienstleister (wg. Mobilfunk)? Es wurde erbittert gezankt, Promoteams der verfeindeten Gewerkschaften lieferten sich vor dem Kantineneingang hinter in feindseliger Nähe zueinander aufgebauten Aktionstischchen tagelang erbitterte Kugelschreiberverschenkungsgefechte. Eventuell kam es gegen Nachmittags auch zu Handgreiflichkeiten, da ist leider nichts verbrieft, aber denkbar wäre es. Es waren wilde Zeiten.
Mein bester Kumpel und ich gefielen uns gar sehr in der Rolle der politisch unzuverlässigen Partisanen ohne echtes Interesse an gewerkschaftlicher Fürsorge, dafür einer unerschöpflichen Aufgeschlossenheit gegenüber kostenlosem Krempel, und nahmen daher wohlfeil Kugelschreiber aus allen Richtungen entgegen, ohne jemals etwas damit zu unterschreiben. Vielmehr benutzen wir sie später dazu, bei saufseligen Kneipenabenden obszöne Zeichnungen auf den Rückseiten von Bierdeckeln anzufertigen. Viel lieber hätten wir sie natürlich galant irgendwelchen blumenschönen jungen Damen angereicht, damit diese damit ihre Telefonnummern auf die Bierdeckel schrieben, aber das kam leider äußerst selten vor. Wahrscheinlich hatten die Damen zuvor die Zeichnungen erblickt. Oder – nicht unbedingt naheliegend, aber auch nicht vollkommen ausgeschlossen – ich hatte zufällig gerade den Verdi-Kuli in der Hand, die Auserkorene hingegen war IG-Metall! Rummsbums, aus die Maus. Dabei hätte sie ja nur was sagen brauchen, und ich hätte aus der anderen Tasche den IG-Metall-Kuli hervorziehen können, und sie hätte ob meiner leicht verschwiemelten, aber in Summe doch hinreichend pragmatisch-schnauzbärtigen Partisanen-Art entzückt jauchzend ihre Nummer niedergeschrieben und wir wären mit den Taschen voller Kugelschreiber in eine damals übliche glückliche Zweisamkeitskiste enteilt. Wir waren jung. Wir hatten Handyempfang. Es hätte so schön werden können. Wurde es aber nicht. Die Mädels damals, alle IG-Metall? Man weiß es nicht. Es ist ja leider generell noch viel zu wenig erforscht, auf welchen Wegen die eher anonyme, weil weltenlenkerische Gewerkschaftspolitik mitunter konkreten Einfluss auf menschliche Einzelschicksale nimmt, dies daher als kleine Anregung für künftige Forschergenerationen. Sozusagen. Man steckt ja bekanntlich eh nich drin. Aber wird schon.